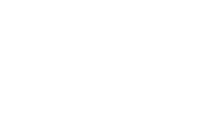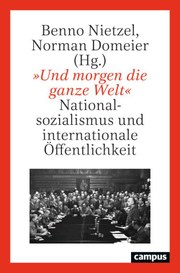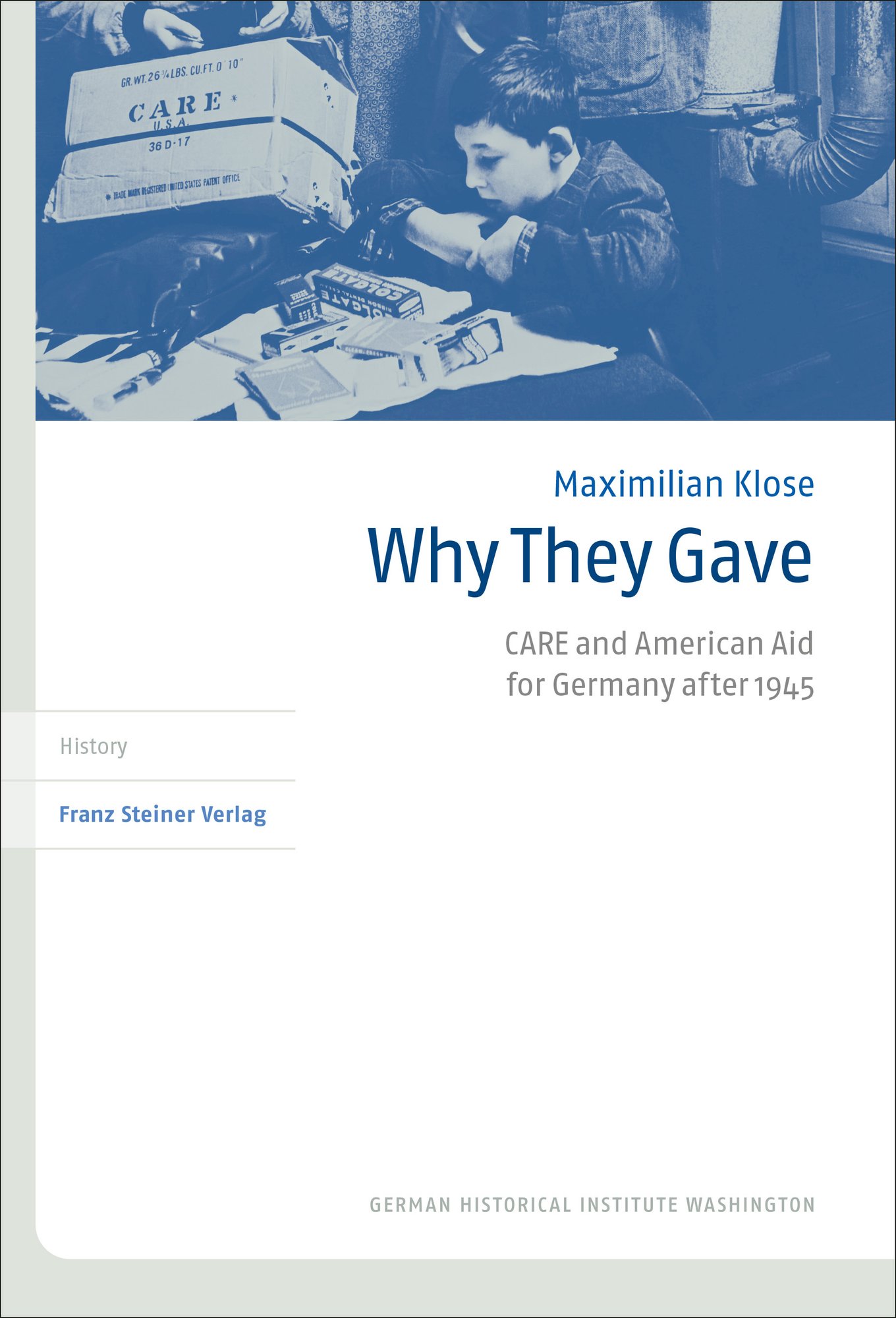Lehre / teaching WiSe 2025
JProf. Dr. Elisabeth Marie Piller
Einführung in die Geschichtswissenschaft
Migration und Mobilität von der Antike bis zur Gegenwart
Achtung: Die Veranstaltungen am 22. Oktober und 19. November 2025 finden jeweils von 12:00 bis 14:00 Uhr im Hörsaal am Fahnenbergplatz statt!
Die Tutorate werden aus Mitteln des Studierendenvorschlagbudgets finanziert.
Kommentar:
Die Vorlesung führt anhand exemplarischer Zugänge zu einem übergreifenden historischen Phänomen in das Studium der Geschichte ein und erläutert epochenspezifische Fragestellungen sowie aktuelle disziplinäre Forschungsansätze, die in unterschiedlichen Teilbereichen der Geschichtswissenschaften entwickelt worden sind. Anhand von Migrationen und Beispielen für Mobilität soll in der Vorlesung transepochal aufgezeigt werden, wie diese Phänomene gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Prozesse beeinflussen. Dabei werden Migration und Mobilität als Treiber globaler Vernetzung, als zentraler Bestandteil historischer Wissensproduktion und -zirkulation, aber auch als Kriegs- und Krisenfolgen diskutiert. Die Einführungsvorlesung soll darüber hinaus zeigen, welche Möglichkeiten die epochen- und raumübergreifende Struktur des Geschichtsstudiums bietet, um Fragen von Migration und Mobilität in ihrer historischen Tiefenschärfe zu verstehen. Das Themenspektrum reicht von Siedlungstätigkeit und Migration im antiken Mittelmeer, Afrika und Asien, über die spätantiken bzw. frühmittelalterlichen Massenmigrationen, die man als „Völkerwanderung“ bezeichnet hat, die mittelalterlichen Migrationen Einzelner und Gruppen im Zuge der Verbreitung des Christentums und des Islams im Mittelmeerraum, bis hin zu früh/neuzeitlichen Migrationen, den Einwanderungsdebatten des 19. und 20. Jahrhunderts sowie der Erfahrung von Flucht und Vertreibung im Zeitalter der Weltkriege.
Zu erbringende Studienleistung:
- Regelmäßige Teilnahme am Tutorat (max. eine Fehlzeit)
- UB-Führerschein
- Klausur, Dauer: ca. 60-120 Minuten (04. Feburar 2026)
Literatur:
- Alexander Rubel, Migration. Eine Kulturgeschichte der Menschheit. Stuttgart 2024. Alexander Rubel, Migration in der Antike. Von Odysseus bis Mohammed. Freiburg 2024.
- Michael Borgolte (Hg.), Migrationen im Mittelalter. Ein Handbuch. Berlin 2014.
- Márta Fata, Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit. Göttingen 2020.
- Philipp Ther, Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa. Bonn 2019.
- Nils Freytag/Wolfgang Piereth, Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches Arbeiten. 5. Auflage. Paderborn 2011.
Veranstaltungsart: Vorlesung
Veranstalter: Historisches Seminar
Termin, Ort: Mi 10 - 12 Uhr (c.t.); 15.10.2025 - 04.02.2026, Paulussaal mit Bühne/Empore/Rückraum und HS Fahnenbergplatz
JProf. Dr. Elisabeth Marie Piller
Kolloquium Transatlantische und Nordamerikanische Geschichte
Kommentar:
Das Kolloquium wendet sich primär an Abschlusskandidatinnen und Abschlusskandidaten und Promovierende. In den Sitzungen werden laufende Qualifikationsarbeiten diskutiert. Das Kolloquium umfasst etwa fünf Mittwochstermine sowie einen Workshop am Nachmittag des 22. November 2025. Das Programm wird zu Beginn des Semesters über die Homepage der Juniorprofessur für Transatlantische und Nordamerikanische Geschichte bekannt gegeben.
Zu erbringende Studienleistung:
- Regelmäßige Teilnahme
- Vorstellung einer Studienarbeit, Dauer: ca. 20-40 Minuten
Veranstaltungsart: Kolloquium
Veranstalter: Historisches Seminar
Termin, Ort: Mi 18:00 – 20:00 Uhr (c.t.); 15.10.2025 - 04.02.2026, HS 4429
JProf. Dr. Elisabeth Piller und Prof. Dr. Dietmar Neutatz
Sowjetunion und USA im Kalten Krieg
Kommentar:
Der Ost-West-Konflikt bestimmte für ein halbes Jahrhundert die internationale Politik. Er hatte aber auch eine prägende Wirkung auf die innere Entwicklung sowohl der USA als auch der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Hauptseminar führt beide Perspektiven zusammen: Wir werden die Geschichte des Kalten Krieges diskutieren und uns mit klassischen historiografischen Fragen (etwa der nach dem Ursprung des Kalten Krieges) auseinandersetzen, dabei aber auch einen Schwerpunkt auf die Wechselwirkungen zwischen Sicherheitspolitik und Binnenentwicklung der beiden Supermächte legen. Dabei wird es nicht ausschließlich um politische Geschichte gehen, sondern es werden auch wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Themen behandelt. Insgesamt zielt das Hauptseminar darauf ab, den wissenschaftlichen Blick für eine vergleichende und verflochtene Geschichte der Supermächte im Kalten Krieg zu schärfen.
In diesem Seminar werden keine Referate gehalten, sondern wir setzen uns mit dem Thema in Gruppenarbeiten, Diskussionen und anderen Formen gemeinsamer Arbeit auseinander.
Das Seminar kann als Masterseminar zur Komparativen Geschichte besucht werden.
Zu erbringende Prüfungsleistung
- Das Abgabedatum für die Hausarbeit (20-25 Seiten) ist der 25. März 2026.
- Mündliche Prüfungen (20 Minuten) nach individueller Absprache, i.d.R. zwischen dem 09. Februar und dem 10. April 2026.
Zu erbringende Studienleistung:
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- 2 Essays, Umfang: je ca. 3 Seiten
- Sitzungsprotokoll, Umfang: ca. 3 Seiten
- Quelleninterpretation, Umfang: ca. 3 Seiten
- Vorbereitende Lektüre, Umfang: ca. 50 Seiten pro Woche
Literatur:
- McCauley, Martin: Russia, America and the Cold War, 1949-1991. London, New York 1998.
- Stöver, Bernd: Der Kalte Krieg. München 2003.
- The Cold War: The Essential Readings. Hg. v. Klaus Larres und Ann Lane. London 2001.
Veranstaltungsart: Seminar
Veranstalter: Historisches Seminar
Termin, Ort: Di 14 - 17 Uhr (c.t.); 14.10.25 - 03.02.26, Kollegiengebäude IV/Übungsraum 2
Dr. Maximilian Klose
Geschichte der Männlichkeiten im 19. und 20. Jahrhundert
Was gilt als „männlich“? Was macht einen „Mann“ aus – und warum eigentlich? Solche Fragen lassen sich weder allgemeingültig noch unveränderlich beantworten. Sie unterliegen einem historischen Wandel, der soziale Ordnungen und Machtverhältnisse prägt. Zudem existiert nicht die eine „Männlichkeit“, sondern eine Vielzahl an Ausprägungen und Idealen, die miteinander konkurrieren und sich gegenseitig beeinflussen.
Die Übung thematisiert diese Wandelbarkeit und Vielfalt von Männlichkeitsvorstellungen und bietet Einblicke in zentrale Theorien, Methoden und Fallstudien, um diese differenziert analysieren zu können. Räumlich und zeitlich liegt der Fokus auf dem deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Raum vom späten 19. Jahrhundert bis zum Kalten Krieg. Behandelt werden Konzepte wie Körper, Emotionen, Sexualität, Ethnizität, Klasse, Krieg und Gewalt, Imperialismus, Vaterschaft sowie Krisenerfahrungen. Auch nicht-westliche und nicht-weiße Perspektiven werden systematisch einbezogen.
Ziel ist es, Studierende zur kritischen Reflexion über Wandel, Persistenz und globale Verflechtungen von Männlichkeiten zu befähigen.
Zu erbringende Studienleistung:
- Regelmäßige Teilnahme (max. 2 Fehlzeiten)
- Sitzungsprotokoll, Umfang: ca. 2 Seiten
- Blog-Beitrag, Umfang: ca. 1 Seite
- Quellenrecherche mit Diskussionsleitung, Dauer: ca. 10 Minuten
Literatur:
- Martschukat, Jürgen / Stieglitz, Olaf (2008): Geschichte der Männlichkeiten. Historische Einführungen. Frankfurt am Main / New York: Campus Verlag.
- Connell, R. W. (1999): Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Übersetzt von Christian Stahl. Opladen: Leske + Budrich.
Veranstaltungsart: Übung
Veranstalter: Historisches Seminar
Termin, Ort: Mi 14 - 16 Uhr (c.t.); 15.10.25 - 04.02.26, Kollegiengebäude IV/4450